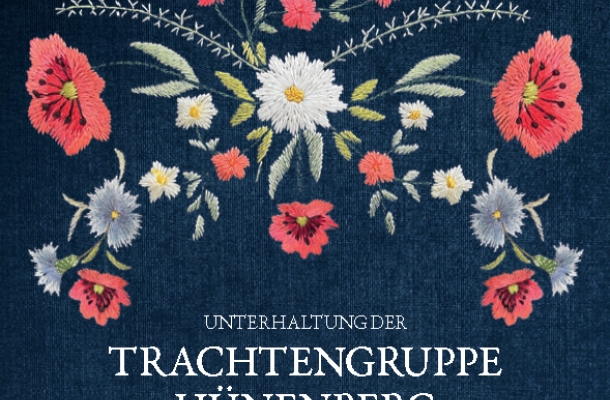50 Jahre Pfarrei Heilig Geist Hünenberg - «Plädoyer für eine Kirche ‘Dazwischen’»

50 Jahre Pfarrei Heilig Geist Hünenberg
«Plädoyer für eine Kirche ‘Dazwischen’»
Evangelium: Lk 13,22-30
Hier gibt es die Predigt als PDF zum Downloaden.
________________________________________
Wie halte ich eine Festpredigt? Wohl nicht als Laudatio auf die Kirche. Man könnte mir Selbstgefälligkeit vorwerfen. Aber auch nicht als Abrechnung. So schlecht war die Hünenberger Vergangenheit beileibe nicht. Lieber dann doch einen Blick in die Zukunft werfen. Nun, ein Hellseher bin ich aber auch nicht. Also wage ich einfach alles auf einmal: Ausgehend von einem Rückblick auf unser Woher möchte ich nach dem Wohin fragen. Und euch an meinen Überlegungen teilhaben haben lassen, wie wir wohl künftig Kirche sein könnten? Dazu gibt es 3 Bilder und einen Blitzeinschlag dazwischen. Los geht’s!
________________________________________
1. Bild: Kirche als Societas Perfecta

Obwohl euch der Ausdruck nicht geläufig sein wird, kennt ihr dieses Bild von Kirche. Als Kirchen wie diese gebaut wurden, war die Welt übersichtlich und das Leben hart und bedroht. Die Kirche war da sinnbildlich Fels in der Brandung, feste Burg, ein Haus voll Glorie. Sie repräsentierte Gott. Der wohnte zwar im Himmel hatte aber mit dem Papst und den Priestern Stellvertreter in die Niederungen der Welt entsandt. Heil und Rettung lagen allein in seiner Hand bzw. in den Händen seiner Stellvertreter. Extra ecclesiam nulla salus. Ausserhalb der Kirche gibt es kein Heil. Das erzeugte abwechselnd Hoffnung und Furcht zugleich. Daraus resultieren religiöse Disziplin aber auch persönlicher Zwang. Hatte man denn eine Wahl? Wer wollte leugnen, dass die Welt Gottes ganz offensichtlich eine andere und bessere war als die, in der man selbst lebte? Das Bild von Kirche sprach für sich.
Es war ausgerechnet der Namensvorgänger des aktuellen Papstes, nämlich Leo XIII., der aus diesem Selbstverständnis im Jahr 1885 überflüssigerweise noch die Lehre einer Societas Perfecta formulierte, einer Kirche, die in sich die «vollkommende Gesellschaft» sei. Er schrieb: «sie (die Kirche) ist eine vollkommene Gesellschaft eigener Art und eigenen Rechtes, da sie alles, was für ihren Bestand und ihre Wirksamkeit notwendig ist, gemäss dem Willen und der Kraft der Gnade ihres Stifters in sich und durch sich selbst besitzt.» (Enzyklika Immortale Dei)
Eine Kirche, die alles hat und in sich trägt, ist sich selbst genug ist. Diese Kirche hatte Macht im Himmel und auf Erden. Sie spendete Sakramente als Belohnung für Linientreue und nicht als Geschenk der Liebe Gottes. Diese Kirche moralisierte und pädagogisierte das, was als Evangelium eigentlich als Frohe Botschaft gedacht ist. Sie meinte das zu dürfen, weil sie als Institution, (ablesbar am Gebäude) den Himmel auf Erden ja selbst schon ein kleines bisschen abbildet.
Diese Kirche ist vergangen. Die Aufklärung und spätestens die 68er Bewegung haben sie an ihr Ende gebracht. Und das II. Vatikanische Konzil hat sie dankenswerterweise auch theologisch abgewickelt.
Aber Vorsicht: Denn dieses Bild von Kirche wirkt weiter. In den Herzen und Gedanken von vielen von uns. In den Bildern, die wir bewusst und unbewusst in uns tragen. Wenn Menschen sich auch 2025 noch bei mir entschuldigen, sie seien schlechte Kirchgänger. Wenn der Glaube noch immer mit Moral verwechselt wird. Wenn wir den Papst und Co. anschauen, als seien sie nicht von dieser Welt. Dieses Bild ist ein schweres Erbe. Es verhindert und blockiert noch immer ganz viel Entwicklung. Nichts gegen Kathedralen, nichts gegen Mozartmessen. Aber sie sind Ausdruck dieses Kirchenbildes. Und wir sind klug beraten, wenn wir wissen, was uns innerlich steuert und leitet.
________________________________________
2. Bild: Kirche als Gemeinde

Das II. Vatikanum korrigierte lehramtlich vieles. Das war Ende der sechziger Jahre. Heraus kam dieses Kirchenbild. Statt der Kirche als Ständegesellschaft wird die Kirche jetzt als Volk Gottes verstanden. Gott redet in dieser neuen Kirche nicht mehr von oben herab. Jetzt sitzen alle auf Augenhöhe. Man nennt dies Communio-Theologie. Alles gehört zusammen, ist vernetzt, denkt, fühlt, feiert, trauert gemeinsam. Es entstand das, was der Soziologe Urs Stäheli als die «Fiktion der Gemeinde» bezeichnet. Pfarrei als Gemeinschaft am Ort in der alle, nach dem Vorbild der Apostelgeschichte regelmässig zusammenkommen, Gemeinschaft leben, Gott feiern. Eine schöne Vision. Und zugleich eine schmerzhafte Illusion.
Das neue Bild von Kirche war gewiss ein Fortschritt und es ist definitiv näher am Evangelium. Aber es war schneller überholt, als es eingeführt war. Kirche als Gemeinde, als Schiffchen Gleichgesinnter im Ozean dieser Welt. Schnell fehlten der neuen Kirche die Gemeindemitglieder. Weil, wer nicht mehr kommen musste, bemerkte das man sonntags auch anderes tun kann. Dass ein Leben ohne Gott oder zumindest ohne Kirche gut möglich ist. Auch realisierten viele, dass die Bewältigungsstrategien, die der christliche Glaube zur Verfügung stellt, in einer immer komplexer werdenden Welt allein nicht mehr ausreichen. Dazu versuchten tausende sich vom quälenden Bild der Kirche als Societas Perfecta endlich und endgültig zu befreien, durch Kirchenaustritt. Wer konnte es ihnen verdenken? Und so wurden aus unterschiedlichen Gründen die Kirchenschiffe leerer und die Kreuzfahrtschiffe voller.
Wir sind Kinder dieses Kirchenbildes. Und doch tragen wir eben auch immer noch Spuren des Kirchenbildes der Societas Perfecta in uns. Zwar spüren und sehen wir, dass das alles irgendwie nicht mehr passt und funktioniert. Aber sie sitzen halt tief, diese Bilder, wie fiese Dämonen – auch, weil wir aktuell keine alternativen Bilder von Kirche sehen. Und so erinnern viele Diskussionen und mancher Aktionismus in unseren kirchlichen Gemeinden, Gremien und Räten irgendwie an das umstellen und neu ausrichten der Möbel auf der Titanic. Wir tun als ob es so weiterginge. Wir versuchen totes wiederzubeleben. Aber das Ende der Reise steht uns längst schon klar vor Augen.
________________________________________

Wir erleben gerade eine gewaltige Zäsur. In der Weltgeschichte kommt das häufiger vor. Kirchlich hatten wir eine vergleichbare Krise seit der Reformation 1517 nicht mehr. Das schüttelt uns durch.
Unsere Welt hat sich in den letzten 50 Jahren rasant verändert. Gut beschrieben hat es der Philosoph Jürgen Habermas mit dem Titel einer «Neuen Unübersichtlichkeit».
Nach Jahren der Prosperität und des Wohlstands nach dem 2. Weltkrieg taumeln wir erneut und ziemlich unvorbereitet, von einer Herausforderung zur anderen und von Krise zu Krise. Kostprobe gefällig? Klima-Krise, Corona-Pandemie, eine KI gesteuerte Zukunft, der Ukraine-Krieg, die Israel-Palästina-Tragödie. Das sind nur die jüngsten und aktuellsten. Dazu kommen all die kleinen und grossen Krisen, die wir im Privaten und Familiären erleben - eben, weil die Welt und das Leben vielfältiger, diverser und damit eben auch unübersichtlicher geworden sind.
Und nicht mehr eindeutig. Denn wenn wir eines gelernt haben angesichts der Diskussionen über Klimawandel, Corona etc. Es gibt keine einfachen und eindeutigen Antworten. Es gibt kein klares ja-oder-nein, gut-oder-böse, richtig-oder-falsch. Alles und jedes hat zwei Seiten oder sogar mehrere. In jeder Situation gilt es individuell, weitsichtig und weise abzuwägen. Und manchmal ist ein abschliessendes Urteil schlicht nicht möglich. Und vielleicht auch nicht nötig.
Und das gilt eben auch für den Glauben und die Kirche. Es gibt Dinge, Situationen und Erfahrungen, die nicht zusammenpassen, die nicht integrierbar sind. Die aber trotzdem ihren Grund und ihre Berechtigung haben. Und ich glaube, wir müssen es einüben, diese Heterogenität auszuhalten. Machen wir es konkret: Ihr als Kirchenchor? Seid ihr Kirche? Seid ihr Teil dieser Pfarreigemeinde im Sinne des II. Vatikanums? Eure Antworten auf diese Frage werden sehr unterschiedlich ausfallen und dann noch sehr situativ. Das gleiche können wir im Blauring fragen, bei den Firmlingen oder den Eltern unserer Erstkommunion Kinder. Oder du, frag du dich: Bin ich Kirche? Und wenn ja, wieviel Kirche bin ich denn? Möchte ich überhaupt in meinem Umfeld als Christin/Christ gelesen werden?
Und wer ist das eigentlich, die Kirche? Wer ist da überhaupt drin in der Kirche? Und wer ist draussen? Welche Kriterien spielen denn da? Und gibt es nicht vielmehr auch irgendwas dazwischen? Wie es ist es denn mit den Menschen, die heute hier nicht mit uns feiern? Verbindet uns mit denen nichts oder doch eigentlich noch viel? Längst doch schon feiern aus der Kirche ausgetretene Menschen trotzdem hier mit uns Gottesdienst und engagierten sich in unseren Pfarrei-Gruppen? Sind die drinnen oder draussen? Gehören die dazu? Irgendwie nein und doch ohne Zweifel ja auch schon, oder?
________________________________________
3. Bild: Kirche im Dazwischen

Das Sowohl-Als-Auch, die Heterogenität, das Dazwischen, sie sind das neue Bild in dem es künftig gilt, Kirche zu sein.
Wie es genau definiert sein wird und aussehen kann – ich weiss es nicht. Und ich habe noch niemand getroffen, der es weiss. Aber es gilt nach wie vor, die Verheissung, die Gott durch den Propheten Jesaja verlauten liess: «Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr! Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht?» (Jes 43,18f)
Das ist recht vage. Aber das passt zu unserem Glauben. Jesus war in seinem Reden und Tun auch längst nicht so logisch und eindeutig (s. Evangelium). Und immer wieder stellt Gott die Verhältnisse, das Sichergeglaubte und Für-Wahr-Gehaltene auf den Kopf. Also Vorsicht! Kleine werden plötzlich gross. Und die Letzten sind unversehens die Ersten. Wer sich für fromm hält bleibt im Himmelreich aussen vor. Auf das Leben folgt der Tod. Und auf den Tod die wundersame Auferstehung. Das ist die Theologie von Karfreitag bis Ostern. Die Grundlage unseres Glaubens. «Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.» (Joh 12,24). Es muss erst etwas sterben, damit Neues entstehen kann.
Irgendwie gleicht unser Zustand dem Karsamstag. Wir hatten eine gute Zeit. Aber ab jetzt kommt es anders. Wir hoffen das Beste. Aber wir wissen noch nicht, wie es sein wird. Wie stehen in einer Leere. Wie stecken in einem Zwischenzustand. Das ist nicht immer schön und bestimmt nicht einfach. Mit Leere können wir allgemein schlecht umgehen. Immer versuchen wir sie zwanghaft zu füllen. Aber das gilt es auszuhalten, jetzt. Das Dazwischen ist jetzt unser Zustand, unser Ort und damit auch Lernort. Der Ort, die Zeit, in der Gott sich der Welt und uns neu zeigt und mitteilt.
________________________________________
Glaube wird künftig vielfältiger sein und sich individueller ausdrücken. Christin/Christ-Sein wird aus einer bewussten Entscheidung heraus resultieren und nicht aus Familientradition. Wir werden keine grossen Gruppen mehr zu Sakramenten führen. Aber wir müssen damit rechnen, dass uns Menschen allen Alters fragen werden, wie sie denn Gott in ihrem ganz persönlichen Leben finden können und ob wir sie in diesem Suchprozess begleiten.
Wir werden eine Kirche sein, die sich nie mehr selbst genügt. Die sich hüten wird, zu behaupten, sie sei das allein-selig-machende, das allwissende und moralisch bessere. Wir werden eine Kirche sein, die aus ihrer leidvollen Geschichte und aus ihrem Scheitern gelernt haben wird. Die sich nie mehr Illusionen hingibt. Die immer damit rechnen wird, dass Gott nochmal ganz anders ist, als sie es als Kirche denkt. Die nie wieder in Routinen verfällt, sondern sich mit offenem Herzen stören lässt, durch das, was an den Wegrändern des Lebens und der Gesellschaft passiert.
Wir werden Christinnen und Christen sein, die mitten in der Welt leben. In den Tragödien des Lebens und in seinen Feierstunden. An Wochen- und an Sterbebetten. In Gesundheit und Krankheit. Im Krieg und im Frieden. Wir werden hoffnungsvoll sein aber angefochten bleiben. Voll Glaube und irgendwie doch auch mit Zweifeln behaftet. Zu Tode betrübt und dann und wann himmelhochjauchzend.
Ich kann dir und uns heute kein anderes Kirchenbild anbieten ausser diesem Bild von einer Kirche im Dazwischen. Und ich weiss für mich, dass ich das gerne suchen und ausprobieren und mitgestalten möchte. Soviel kann ich sagen. Und wünsche mir so, dass du mit dabei bist. Das ist mein grosser Wunsch! ________________________________________
Wir dürfen heute mit grosser Dankbarkeit zurückschauen, auf das, was gewesen ist. Wir dürfen denen unseren allergrössten Respekt zollen, die sich in den letzten 50 Jahren hier engagiert und die sich nicht selten aufgerieben haben – hier und da bis zur Selbstaufgabe. Wir dürfen wertschätzen, was erreicht worden ist und grossherzig verzeihen, was nicht gelungen und wo Unrecht geschehen ist.
Das Judentum und das Alte Testament sahen alle 50 Jahr ein sogenanntes Jubeljahr vor. In diesem Jubeljahr erliess man einander sämtliche Schuld und Schulden, den Sklaven wurde die Freiheit geschenkt und alles unrechtmässig Erworbene zurückgegeben. Das Jubeljahr war eine grossartige Errungenschaft, die Uhren auf Null und den sozialen- und religiösen Frieden wiederherzustellen. Wäre das nicht auch eine Idee für jetzt und heute?
Wenn wir das jetzt und heute schaffen würden. Das wäre doch was!
Dann könnten wir alle alten Bilder und schädlichen Prägungen im Frieden zur Seite legen. Und neu anfangen. Als kleine, leise, bescheidene Kirche in Hünenberg. Als Christinnen und Christen, die versuchen, es einfach irgendwie gut zu machen. Als Menschen, die nichts mehr aber auch nichts weniger bewegt und motiviert, als die Hoffnung, dass Gott uns auch künftig führen wird. Wie und wohin– dass überlassen wir dann getrost ihm.
Christian Kelter, 24.8.2025
________________________________________
Die Predigt ist inspiriert von:
Michael Schüssler, «Es kommt was ins Rutschen. Eine theologische Reise an die Kipppunkte der Gegenwart», Ostfildern, 2025.
Jan Loffeld, «Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz», Freiburg i.B., 2024.
Meine Gedanken führen weiter, was ich hier beschrieben habe:
Christian Kelter, «Reboot. Jetzt mehr Kirche wagen», Würzburg, 2022.